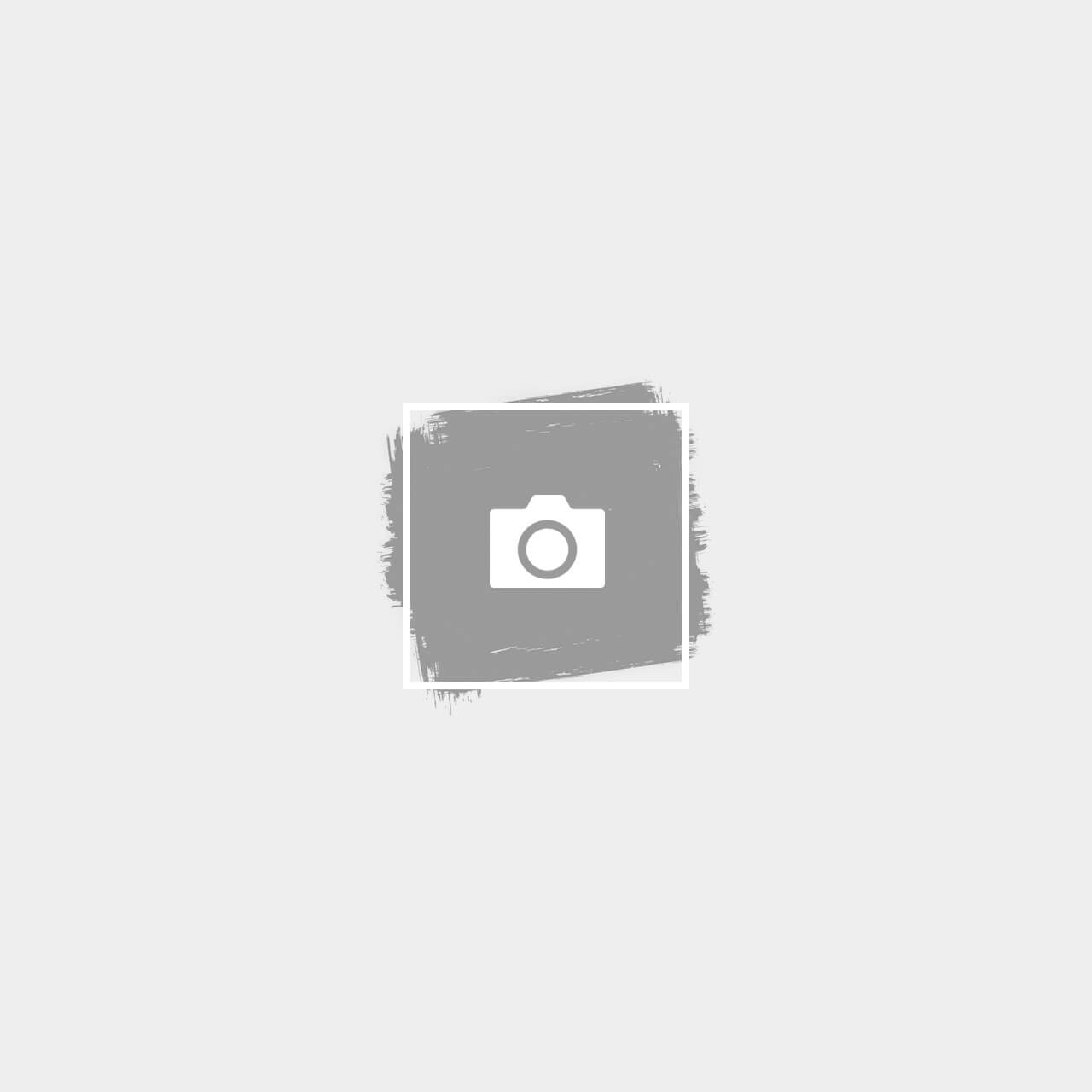1.
Seit der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 sind auf sogenannte Dauerschuldverhältnisse, worunter auch Mietverträge zu zählen sind, grundsätzlich die bundesdeutschen Gesetze anwendbar. Soweit es allerdings im Rahmen eines solchen Dauerschuldverhältnisses auf Sachverhalte ankommt, die bereits vor der Wiedervereinigung, also zu DDR-Zeiten, abgeschlossen waren, sind deren Rechtsfolgen auch heute noch nach dem Recht der DDR zu beurteilen. Demgemäß hat der Bundesgerichtshof entschieden, daß die Frage, wann der Mieter verpflichtet ist, Einbauten in der Wohnung, die zu DDR-Zeiten von ihm vorgenommen wurden, am Ende des Mietverhältnisses zu entfernen, nach dem Recht der DDR beurteilt und entschieden werden muß (Artikel 232 § 2 EGBGB; BGHZ 134, 170, 175; NJ 1999, 486).
Konkret geht es heute in vielen Fällen darum, daß Mieter zu Beginn des Mietverhältnisses in DDR-Zeiten Ein- und Umbauten in den Wohnungen vorgenommen haben, welche unter Zugrundelegung bundesdeutscher Rechtsvorstellungen typischerweise am Ende des Mietverhältnisses vor Rückgabe an den Vermieter von dem Mieter entfernt werden müssen, dagegen aber bei richtiger Anwendung der Kriterien des Rechts der DDR (§§ 111 bis 113 ZGB) von dem Mieter nicht entfernt zu werden brauchen. Ein geradezu klassischer Beispielsfall ist der von dem Mieter vorgenommene Einbau von sogenannten Styroporplatten an der Decke und an den Wänden der Wohnung. Die Wohnungsbaugenossenschaften und kommunalen Wohnungsverwaltungen in den neuen Bundesländern verlangen heute deren Beseitigung bei Auszug der Mieter. Dabei können sie sich auf Urteile mehrerer Amtsgerichte berufen (z.B.: AG Potsdam v. 7.5.2003, 25 C 172/02). Nach Ansicht des Verfassers sind dagegen Mieter solcher DDR-Altmietverträge bei richtiger Anwendung des DDR-Zivilrechts hierzu überwiegend nicht verpflichtet.
2.
Nach Ansicht des Verfassers ist Grundvoraussetzung für eine rechtlich richtige Beurteilung dieser Fälle die Erkenntnis, daß das Mietrecht des BGB einerseits und des ZGB/DDR andererseits trotz zahlreicher äußerlicher Ähnlichkeiten auf vollkommen unterschiedlichen Grundsätzen beruhen und Ausdruck zweier einander widersprechender Weltanschauungen bzw. Gesellschaftsordnungen mit völlig unterschiedlichen Wertmaßstäben sind. Diese eigentlich selbstverständliche Tatsache scheint sich in der Praxis der Amts- und Landgerichte bei der heutigen Anwendung des DDR-Mietrechts nicht in aller Deutlichkeit niederzuschlagen. So stellen die bisher veröffentlichen Entscheidungen zur Auslegung des DDR-Rechtsbegriffs des „gesellschaftlichen Interesses“ im Sinne von § 112 II ZGB maßgeblich auf wirtschaftliche Erwägungen ab, ohne dabei die damaligen Zwecke der Vorschrift und deren quasi verbindliche Auslegung durch das Oberste Gericht der DDR und der offiziellen Rechtsliteratur hinreichend zu beachten (LG Potsdam WM 2000, 605; AG Zwickau WM 1999, 217; AG Köpenick MM (Mietermagazin des Berliner Mietervereins) 2000, 333; LG Berlin MM 1999, 394 = ZMR 2000,24; OLG Jena OLG-NL 1999, 51)
a)
Ausgangspunkt der Rechtslage hinsichtlich der Beantwortung der Frage nach der Beseitigungspflicht ist im deutschen Bürgerlichen Recht der Grundsatz, daß der Mietvertrag als ein schuldrechtliches Dauerverhältnis aufgefaßt wird, auf welches die allgemeinen schuldrechtlichen Grundsätze anwendbar sind. Dies bedeutet wiederum, daß das Rechtsverhältnis zwischen Wohnungsmieter und –vermieter grundsätzlich beruht auf dem Gedanken der Vertragsfreiheit und dem alle gegenseitigen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien prägenden Prinzip, nach welchem „Verträge so auszulegen sind, wie Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte es erfordern“ (§ 157 BGB; siehe auch § 242 BGB). Weiter ist Ausgangspunkt der Beurteilung der Rechtslage der Gedanke, daß der Vermieter gegenüber dem Mieter die Pflicht hat, ihm die Wohnung in dem zu Vertragsbeginn vereinbarten Gebrauchszustand zu überlassen und sie während des gesamten Vertragsverhältnisses in diesem Zustand zu erhalten, wohingegen der Mieter seinerseits verpflichtet ist, die Wohnung auch in diesem Zustand wieder zurückzugeben, wobei natürlich die auf der vertragsgemäßen Abnutzung der Wohnung beruhenden Verschleißerscheinungen von dem Gesetz ebenfalls als vertragsgemäß und nicht von dem Mieter zu beseitigen bewertet werden (vgl. § 556 BGB – alt).
Wenn ein Mieter danach während seiner Besitzzeit in der Mietwohnung Einbauten, Einrichtungen, Installationen oder gar bauliche Veränderungen – soweit dies überhaupt zulässig ist – vornimmt, muß er dieselben grundsätzlich vor der Rückgabe an den Vermieter beseitigen, es sei denn, dieser möchte eine mit der Mietwohnung dauerhaft verbundene Einrichtung gegen eine angemessene Entschädigung des Mieters übernehmen (§ 547 a BGB – alt) oder die Vertragsparteien einigen sich auch über eine kostenlose Belassung der Einrichtung in der Wohnung. Da der Mieter gegenüber dem Vermieter grundsätzlich einen Anspruch auf Zustimmung zu der Anbringung derartiger Einrichtungen (Holzverkleidungen, abgehängte Decken, Fußbodenbeläge) in einer dem Charakter der Mietwohnung entsprechenden Weise hat, schließt das Einverständnis des Vermieters mit dem Einbau die Pflicht des Mieters, diesen am Ende des Mietverhältnisses wieder zu entfernen, grundsätzlich nicht aus. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz macht die Rechtsprechung wiederum dann, wenn bei verständiger Wertung der Einverständniserklärung des Vermieters mit der Maßnahme der Mieter anläßlich des Einbaus einer Einrichtung davon ausgehen durfte, daß er am Ende des Mietverhältnisses diese nicht wieder auf eigene Kosten zu beseitigen haben würde. Dies wird von der Rechtsprechung dann angenommen, wenn der Mieter an der Wohnung auf Dauer angelegte, über das Mietverhältnis hinausreichende Wertverbesserungsmaßnahmen vornimmt, die nur mit erheblichem Kostenaufwand beseitigt werden können und deren Entfernung das Mietobjekt in einen schlechteren Zustand zurückversetzen würde (z.B. Einbau eines Kachelvollbades, Austausch von Kohleöfen gegen Nachtspeicherheizung, Verklebung eines hochwertigen Teppichbodens; Sternel, Mietrecht, 3. Auflage, IV, RN 603, 604). Hier muß zwar der Mieter bei dem Vermieter dessen Einverständnis einholen, zu dessen Abgabe der Vermieter verpflichtet ist, wenn die Maßnahme des Mieters wirtschaftlich sinnvoll ist, der Vermieter muß sich aber seinerseits anläßlich seiner Einverständniserklärung ausdrücklich vorbehalten, daß er auf der Entfernung der Einbaumaßnahme am Ende des Mietverhältnisses besteht. Unterläßt er diesen Entfernungsvorbehalt bei der Einbaugenehmigung, dann braucht der Mieter die Einbauten bei seinem Auszug nicht zu entfernen.
Demgemäß muß ein Mieter, der anläßlich seines Einzuges in eine untapezierte Wohnung mit gängigen Tapeten tapeziert hat, dieselben bei seinem Auszug nicht entfernen, weil der Mieter damit das Mietobjekt erst zu dem vereinbarten Nutzungs- und Gebrauchszweck hergerichtet hat (bloße Renovierung). Hat der Mieter dagegen anstelle gängiger Tapeten die Wohnung mit einer ausgefallenen Holzmasertapete, einer Fototapete oder einer Styropordeckenverkleidung versehen, dann handelt es sich nach Ansicht der Rechtsprechung, die sich hierbei im wesentlichen auf den Grundsatz von Treu und Glauben mit Rücksicht auf wirtschaftliche Interessen des Vermieters beruft, nicht um eine auf Dauer angelegte, über das Mietverhältnis hinausreichende Wertverbesserungsmaßnahme, weil sie davon ausgeht, daß ein durchschnittlicher Nachmieter gegenüber dem Vermieter auf der Entfernung der Styroporplatten bzw. anderer „extravaganter“ Innenverkleidungen bestehen wird. Nach deutschem Bürgerlichem Recht muß der Mieter also Styroporplatten grundsätzlich am Ende des Mietverhältnisses entfernen.
b)
Obwohl wie eingangs dargelegt, in den neuen Bundesländern bauliche Maßnahmen der genannten Art, die zu DDR-Zeiten vorgenommen wurden, nach dem Zivilgesetzbuch der DDR auch heute noch zu beurteilen sind, beantworten die dem Verfasser bekannten Entscheidungen mehrer Amtsgerichte die Frage der Beseitigungspflicht des Mieters bei Styroporplatten im Ergebnis genau so als gälte das Bürgerliche Recht der Bundesrepublik. Sie steht dabei auf dem Standpunkt, daß der Einbau von Styroporplatten nicht „im gesellschaftlichen Interesse“ im Sinne der Vorschrift des § 112 II Zivilgesetzbuch/DDR gelegen habe. Dabei bewertet sie offenkun-dig den unbestimmten Rechtsbegriff des „gesellschaftlichen Interesses“ des Zivilgesetzbuchs der DDR in derselben Weise, als handele es sich hierbei um den heute maßgeblichen schuldrechtlichen Begriff von „Treu und Glauben“.
Gemäß § 112 II ZGB hat der Mieter bauliche Veränderungen, die er ohne Zustimmung des Vermieters in der Wohnung vorgenommen hat, auf Verlangen des Vermieters zu entfernen und den ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Weiter heißt es: “Diese Pflicht entfällt, wenn die baulichen Veränderungen zu einer Verbesserung der Wohnung geführt haben, die im gesellschaftlichen Interesse liegt“.
Die rechtswissenschaftliche Literatur der DDR war sich im Ergebnis einig darüber, daß § 112 II nicht nur auf bauliche Veränderungen im engeren Sinne, sondern auch auf Einbauten und Installationen in der Mietwohnung anzuwenden war (Bericht des Präsidiums an die 16. Plenartagung des Obersten Gerichts, Neue Justiz, 1980, 345; H. Krüger, NJ 1976, 621; Hildebrandt, NJ 1976, 261).
Entscheidend ist im vorliegenden Fall also, wie der unbestimmte Begriff des „gesellschaftlichen Interesses“ im Zivilrecht der DDR von einem heutigen bundesdeutschen Richter angewendet werden muß.
Nach inzwischen gefestigter Rechtsauffassung des Bundesgerichtshof muß der Richter bei Fällen der vorliegenden Art, bei denen es auf die rechtliche Beurteilung von zu DDR-Zeiten abgeschlossenen Sachverhalten geht, exakt dieselben Auslegungsmethoden anwenden, die von dem DDR-Richter vor der Wiedervereinigung und auch vor der sogenannten Wende in der DDR Anfang 1990 zu beachten waren (so z.B.: NJW 94, 1793).
Hierbei ergibt sich, daß das bundesdeutsche bürgerliche Schuldrecht und das DDR-deutsche Zivilrecht von vollkommen unterschiedlichen Wertungsgrundsätzen geprägt sind. Das Zivilrecht der DDR war geprägt von der ökonomischen Lenkungsfunktion der als Einheit verstandenen gesamten sozialistischen Rechtsordnung. Danach bestand die besondere Aufgabe des sozialistischen Zivilrechts darin, die von der Arbeiterklasse beschlossenen gesellschaftlichen Zielstellungen auf dem Gebiet der Ware-Geld-Beziehungen zwischen den Bürgern untereinander und den Bürgern mit den Betrieben zu verwirklichen, soweit es um die Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse der Bürger ging. Im Ergebnis sollte damit die Hauptaufgabe des Zivilrechts darin bestehen, „die Entwicklung der Bürger zu allseitig gebildeten sozialistischen Persönlichkeiten“ zu ermöglichen, soweit dies „die weitere Erhöhung des materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes“ zuließ (§ 1 ZGB der DDR vom 19.6.1975, Präambel; Zivilrecht, 2. Auflage 1985, 25 ff.).
Was im Einzelnen jeweils unter dieser Prämisse im Rahmen der Anwendung der einzelnen Bestimmungen des ZGB als „im gesellschaftlichen Interesse“ liegend anzusehen war, wurde im Rahmen der jeweils erreichten Entwicklungsetappen des Wirtschaftssystems von der Partei der Arbeiterklasse im Rahmen ihrer Aufgabe, „deren Vorhut“ (auf „Neudeutsch“: Elite) zu bilden, entschieden.
Danach ergibt sich hier folgendes:
Auf der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED wurde im Rahmen des Wohnungsbauprogramms der Beschluß gefaßt, daß die Erhaltung des vorhandenen Wohnungsbestandes wesentliches Ziel der Wirtschaftspolitik werden sollte. Demgemäß sollten die Initiativen der Mieter „beim Um- und Ausbau sowie bei der Modernisierung ihrer Wohnungen“ direkt und ökonomisch stimuliert werden (H. Krüger, NJ 1974, 389 ff.).
Gemäß § 111 Satz 2 ZGB ist der Vermieter verpflichtet, einer baulichen Veränderung des Mieters zuzustimmen, wenn diese zu einer „im gesellschaftlichen Interesse liegenden“ Verbesserung des Wohnraums führt. Im Hinblick auf die zu DDR-Zeiten bestehende Knappheit an Baumaterial, die Mieter zu baulichen Maßnahmen in Altbauwohnungen anzuregen, legten sowohl die rechtswissenschaftliche Literatur als auch die Rechtsprechung des obersten Gerichts der DDR einen sehr großzügigen Maßstab zugunsten der Mieter an. Danach wurde ein gesellschaftliches Interesse an einer baulichen Veränderung des Mieters schon dann bejaht, wenn erstens die erforderlichen bautechnischen Bedingungen für die Maßnahme vorlagen, zweitens die Veränderung ohne wesentliche Beeinträchtigung der Interessen des Vermieters und der Rechte der benachbarten Mieter durchgeführt werden konnten, drittens die Restnutzungsdauer des Altwohngebäudes es unter ökonomischen Gesichtspunkten rechtfertigte, finanzielle Mittel für Verbesserungsmaßnahmen aufzuwenden und schließlich viertens die Maßnahme ein gesellschaftlich anzuerkennendes Wohnbedürfnis des Mieters befriedigte (OG, NJ 1975, 644; OG, NJ 1974, 27; Hildebrandt, NJ 1976, 261 ff.; H. Krüger, Verbesserung des Wohnraums durch bauliche Veränderungen und durch die Ausstattung mit Einrichtungsgegenständen, NJ 1976, 619, 620).
Wendet man diese Kriterien auf den Einbau von Styropordeckenplatten an, dann kann eigentlich kein Zweifel mehr daran bestehen, daß ein DDR-Gericht den Mieter bei seinem Auszug nicht zur Beseitigung dieser Platten verurteilt hätte. Angesichts der oben genannten Parteibeschlüsse zur Stimulierung von Mieterinitiativen hätte es ein gesellschaftlich anzuerkennendes Wohnbedürfnis des Mieters an der Anbringung der Styropordeckenplatten anerkannt und eine wesentliche Beeinträchtigung der Interessen des Vermieters, bei dem es sich ja zu DDR-Zeiten meistens um einen sozialistischen Betrieb handelte, verneint.
3.
Es bleibt hier noch die Frage zu klären, inwieweit die Tatsache, daß das Zivilrecht der DDR kurz vor deren Aufgehen in der Bundesrepublik Deutschland „verbürgerlicht“ worden ist, auf das oben gefundene Ergebnis einen Einfluß hat.
Das am 17. Juni 1990 in Kraft getretene Verfassungsgrundsätzegesetz der DDR bestimmt in § 1 II, daß Rechtsvorschriften der DDR im Sinne eines freiheitlich-demokratischen Rechtsstaates auszulegen sind und daß Bestimmungen, welche auf die sozialistische Staats- und Rechtsordnung ausgerichtet sind, als aufgehoben gelten. Dementsprechend hat bereits Artikel 4 in Verbindung mit Artikel 2 des Staatsvertrages vom 18 Mai 1990 über die Einführung der Währungs- und Sozialunion klargestellt, daß fortbestehendes Recht der DDR gemäß den Grund- und Leitsätzen der freiheitlichen, demokratischen, rechtsstaatlichen und sozialen Grundordnung auszulegen sind. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der Untergerichte geht deshalb bei der Anwendung des Zivilgesetzbuchs der DDR davon aus, daß für seine Auslegung nicht mehr die Grundsätze sozialistischer Gesetzlichkeit und Parteilichkeit, sondern die Auslegungsgrundsätze des sozialen Rechtsstaats an deren Stelle getreten sind (Palandt/Heinrichs, 60. Auflage, Artikel 230 EGBGB, RN 4).
Wenn man also den hier anzuwendenden Rechtsbegriff der „gesellschaftlichen Interessen“ als eine solche Ausprägung typisch sozialistischer Rechtsvorstellungen betrachtet, welche mit den Grundsätzen der heutigen bürgerlichen Rechtskultur unvereinbar ist, ansieht, dann wäre die hier kritisierte Rechtsprechung der Instanzgerichte zur Frage der „Styroporplatten“ wieder vertretbar.
Allerdings tendiert der BGH aufgrund zutreffender, rechtsstaatlicher Überlegungen dahin, den Begriff der „gesellschaftlichen Interessen“ auch heute noch in der gleichen Weise auszulegen, wie dies oben unter Ziffer 2. dargelegt worden ist. Nach Auffassung des Verfassers ist diese Ansicht auch mit in dem Verfassungsgrundsätzegesetz vom 17. Juni 1990 bzw. dem Ersten Staatsvertrag vereinbar. In diesem Zusammenhang spielt eine entscheidende Rolle, daß das Zivilgesetzbuch der DDR, wie auch alle anderen Rechtsvorschriften der DDR, aus bundesdeutscher Sicht innerstaatliches Recht sind und deshalb nicht wie im Falle ausländischen Rechts mit dem Argument, sie verstießen gegen den innerstaatlichen ordre public der Bundesrepublik, verworfen werden können. (vgl.: Kegel, Internationales Privatrecht, 4. Aufl. 1987, S. 69) Artikel 9 IV Satz 2 des Einigungsvertrages, durch welchen fortbestehendes DDR-Recht zu sogenanntem „partiellem Bundesrecht“ erklärt wird, hat diese Rechtsauffassung untermauert.
Der BGH begründet sein Postulat von der möglichst authentischen Auslegung fortgeltender unbestimmter Rechtsbegriffe des ZGB schließlich mit dem Vertrauensschutzgrundsatz, also dem Kern des Rechtsstaatsprinzips. Der gebiete es, von dem bisherigen Normenverständnis auszugehen, soweit nicht die anzuwendende Rechtsnorm mit rechtsstaatlichen Grundsätzen schlechthin unvereinbar sei (BGH 124, 277; NJW 94, 1793; NJW 99, 3332; BGH 123, 68).
Dr. Robbert
Rechtsanwalt